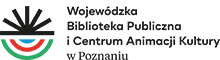In der Vergangenheit war das Holz ein allgemein zugänglicher Baustoff. Es ließ sich leicht bearbeiten, aber es war nicht sehr beständig und war zerstörungsanfällig. Heute sind relativ wenige anmutige Holzbauten erhalten geblieben, auch wenn Wielkopolska eine Region ist, in der die aus Holz gefertigten kleinen Kirchen oder Windmühlen auch außerhalb der Freilichtmuseen überdauerten.
Die größte Gruppe (ca. 280) derartiger Denkmäler bilden die Kirchen. Ihre Zahl, ihr Erhaltungszustand und die Vielfalt der Formen finden in den sonstigen Regionen kein Pendant.
Die Form und die Bauart von Holzgebäuden blieben lange Zeit unverändert. Es dominierte der Blockbau, aufeinander gelegte Bohlen, an den Ecken durch zueinander angepasste Ausschnitte verbunden. Die Bohlen sind grundsätzlich unter dem Putz versteckt. Nur beim Bau einer kleinen Anzahl von Holzkirchen verwendete man die sog. polnische Konstruktion mit fest untereinander verbundenen Vertikalstützen, deren Zwischenräume durch Querbalken ausgefüllt sind. Diese Konstruktion vertreten in Wielkopolska u.a. die Kirchen in Stara Wiśniewka im Landkreis Złotów (1647) und in Węglewo im Landkreis Posen (1818).
Ein wenig stärker verbreitet war die Skelettkonstruktion (auch als Mast-Rahmen-Konstruktion bekannt), die aus miteinander durch waagerechte Balken unten und oben sowie durch schräge versteifende Zusatzelemente verbundenen Masten besteht. Die Zwischenräume der Wände füllte man mit Holz, mit dem mit Häcksel vermischten Lehm oder mit Ziegelsteinen aus.
Manchmal ist die Bauart schwer zu erkennen, weil die Wände von außen und von innen meist mit Holz verkleidet (verschalt) sind. Manche Fachwerkkirchen fallen bereits von Ferne auf, wenn die Holzkonstruktion (in natürlicher Farbe oder schwarz bestrichen) mit getünchten oder grauen Zwischenräumen kontrastiert wurde. So geschmückte Gotteshäuser befinden sich u.a. in Oborniki (Heiligkreuzkirche, 1766), in Uzarzewo im Landkreis Posen (1749) oder in Dąbcze im Landkreis Leszno (1666-68).
Die Grundrisse der großpolnischen Holzkirchen sind meist ziemlich einfach. Es überwiegen rechteckige Schiffe mit einem ein wenig schmaleren Presbyterium, das mit einer einfachen oder (viel häufiger) dreiseitigen Wand endet. Die Grenze zwischen dem Presbyterium und dem Schiff ist häufig unten durch eine Stufe und oben durch einen Regenbogenbalken markiert, der ein Konstruktionselement und gleichzeitig ein Schmuckelement ist (meist ist er schön profiliert, enthält eine fromme Inschrift oder eine Mitteilung über die Stiftung der Kirche, auch ein Kruzifix und nicht selten die den Gekreuzigten anbetenden Gestalten der Muttergottes und des hl. Johannes).
Die Dächer sind meist mit Schindeln, Blech oder Schiefer gedeckt. Als charakteristisch für Großpolen erachtet man Kirchen, in denen das Schiff und das Presbyterium über ein gemeinsames Dach verfügen, wodurch die Dachtraufe im engeren Teil des Gotteshauses (Presbyterium) stärker herausragt.
In solcher einfirstigen Form baute man bei uns die Kirchen bis zur zweiten Hälfte des 18. Jh. Ein wenig später erschienen Kirchen mit zwei Firsten – getrennt für das Schiff und für das Presbyterium. Die ältesten von ihnen (Mitte des 16. Jh.) befinden sich in Kłodawa, Słupca und Wierzenica (Landkreis Posen). Das Gotteshaus in Mórka (Landkreis Śrem) vom Ende des 16. Jh. – mit Holzskelettkonstruktion, deren Zwischenräume mit Lehm ausgefüllt sind, ist das älteste erhalten gebliebene Beispiel einer Fachwerkkirche.
In späteren Jahren bereicherte man die Form von Holzkirchen und einzelne Elemente der Ausstattung. In der Kirche in Brody (1670-73; Landkreis Nowy Tomyśl) erschienen zum ersten Mal die Seitenkapellen, die mit dem Schiff und mit dem Presbyterium die Form eines lateinischen Kreuzes bildeten. Diese Lösung verwendete man später u.a. in Błażejewo im Landkreis Śrem (1675-76), in Ostrów Kościelny im Landkreis Słupca (1717) oder in Czermin im Landkreis Pleszew (1725), durch den 1720 erfolgten Anbau von Kapellen in einer um 91 Jahre jüngeren Kirche auch in Popowo Kościelne (Landkreis Wągrowiec).
Manche Kirchen errichtete man auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes (mit gleichen Armen), nicht selten mit polygonaler oder kreisförmiger Erweiterung am Kreuzungspunkt der Arme. Diese Form wurde u.a. in Buk (1760) verwendet, wo der kreisförmige zentrale Teil von 12 Säulen abgegrenzt ist, die eine Pseudokuppel mit einer großen Laterne tragen, in der über einen achtseitigen höheren Mittelteil (vermutlich aus der zweiten Hälfte des 18. Jh.) verfügenden Kirche des hl. Fabian und Sebastian in Krotoszyn und in der auf dem Friedhof befindlichen Fachwerkkirche mit einer Scheinkuppel (1777) in Jutrosin.
Die Innenräume der Holzkirchen besaßen Flachdecken, Balkendecken oder Kassettendecken, auch wenn es daneben andere Lösungen gab, z.B. in Czerlejno (Landkreis Posen, 1743), in Ociąż (Landkreis Ostrów Wielkopolski; 1785-86), in Golina (Landkreis Jarocin, 2. Hälfte des 17. Jh.) oder in Grębanin (Landkreis Kępno; 1615).
Die Wände der Innenräume behalten die natürliche Holzfarbe bzw. sind glatt bemalt oder enthalten Muster oder Ornamente. Manchmal begegnet man einer Polychromie (an den Wänden, an der Decke, am Geländer des Chors), deren bestes Beispiel (ca. aus dem Jahr 1639) sich in Tarnowo Pałuckie befindet. Eine interessante Polychromie im Stil der Renaissance und des Barock ca. aus den Jahren 1695-99 ist in der Kirche in Słopanowo (Landkreis Szamotuły) erhalten geblieben. In Nowa Wieś Królewska (Landkreis Września) entdeckte man vor kurzem Überbleibsel einer Polychromie vom Ende des 16. Jh.
Eine besondere Gruppe sind Kirchen, die als Holzkonstruktionen Lösungen vervielfältigen, die in den gemauerten Kirchen verwendet sind, wie z.B. in Drzeczkowo im Landkreis Kalisz (1775), wo der Grundriss des lateinischen Kreuzes um einen achtseitigen zentralen Teil mit einer Bekrönung ergänzt wurde, die eine Kuppel nachahmt (den Eindruck eines Baus aus Ziegelsteinen steigert die Verputzung eines Teils der Wände), in Łomnica im Landkreis Nowy Tomyśl (1768-70) – in einer kleinen Kirche mit einer unverhältnismäßig dominierenden Scheinkuppel, in Łęki Wielkie im Landkreis Grodzisk Wielkopolski (1776), auch auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes, mit Außenanbauten und einem durch abgestumpfte Ecken abgegrenzten Zentralteil. Es erschien auch eine geringe Zahl von dreischiffigen Lösungen, z.B. in der Kirche in Wylatowo im Landkreis Mogilno (1761-63), in Skoki (1737), in Grzegorzew im Landkreis Koło (1776, später ausgebaut) oder in Grzybowo im Landkreis Września (1757).
Kirchen aus Holz errichteten auch die Protestanten. Meist vertraten sie einfache Formen, wie z.B. die 1787 erbaute Kirche in Herburtowo im Landkreises Czarnków-Trzcianka, die auch dadurch interessant ist, dass sie ein von außen zusätzlich durch ein Skelett aus Bohlen verstärkter Blockbau ist, oder die Kirche in Krosno im Landkreis Posen (1779-81). Es gab aber auch prachtvollere Kirchen, wie z.B. jene in Miejska Górka (1777-78) und in Ostrów Wielkopolski – in einer jeden dieser Kirchen gibt es zwei übereinander errichtete Balkons mit barocker Verzierung. Durch Architektur und Verzierung zeichnet sich die 1582 erbaute ehemalige evangelische Kirche mit einem Turm aus dem Jahr 1661 in Brokęcino im Landkreis Złotów aus.
Kirchen aus Holz baute man ebenfalls im 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20. Jh. Es wurden dabei Lösungen aus vergangenen Jahrhunderten verwendet.
An manchen Kirchen (auch an den gemauerten) sind Holzglockentürme erhalten geblieben. Die gewaltige Mehrheit von ihnen sind Skelettkonstruktionen auf dem Grundriss eines Quadrats mit verschalten Wänden.
Das am besten erhaltene adelige Gutshaus ist das teils umgebaute Gutshaus in Koszuty im Landkreis Środa Wielkopolska, ein anmutiger Sitz des Heimatmuseums der Landschaft Środa Wielkopolska.
Der größte kleinstädtische Wohnhauskomplex alter Bauart ist an der Łacnowo-Str. in Zduny erhalten geblieben. Einzelne Häuser mit Laubengängen gibt es noch in Rakoniewice, Pyzdry, Poniec, Stęszew oder Krotoszyn.
Eine Besonderheit ist das in der Region letzte erhalten gebliebene Rathaus aus Holz in Sulmierzyce, heute ein Sitz des Heimatmuseums der Landschaft Sulmierzyce.